CarnifexUltra
Neues Mitglied
Ein paar ausgewählte Zitate aus Stephan Malinowskis Dissertation von 2001 an der Tech. Uni Berlin, erschienen als Band 4 der Reihe Elitenwandel in der Moderne bei De Gruyter, zum Glück aber gedruckt vom Fischer-Verlag, das bedeutet bloß 30€ statt 110€ oder mehr bei De Gruyter.
2020 veröffentlichte der Autor eine aktualisierte und überarbeitete Fassung auf Englisch: Nazis and Nobles, und 2021 das hier im Forum schon mehrmals erwähnte Die Hohenzollern und die Nazis.
Ein Schwachpunkt an der Arbeit ist die Beschränkung auf "Deutschland", der Adel lässt sich nicht in die kleinbürgerliche Vorstellung vom Nationalstaat pressen der zudem in der Form erst enstehen würde, er definiert sich durch seine weitverzweigten Verwandtschaften an den internationalen Höfen und Häusern, sowie seinen ebenso weit verzweigten Stammbaum. Gerade bei einem "Weltkrieg" ist es eine schwerwiegende Beschneidung alles außerhalb "Deutschlands" auszublenden. 1917 nannte sich das ehemals deutsche Haus Sachsen-Coburg und Gotha um in Windsor, die British Royals, Queen Viktoria war Wilhelms II. Großmutter, wird mit keinem Wort erwähnt und auch Habsburg wird keine Handvoll Male erwähnt.
Zudem ist selbst innerhalb Deutschlands der Fokus zum allergrößten Teil bei Preussen, das mag z.T. an der Quellenverfügbarkeit liegen die mit dem Preußischen Staatsarchiv vermutlich besonders gut ist.
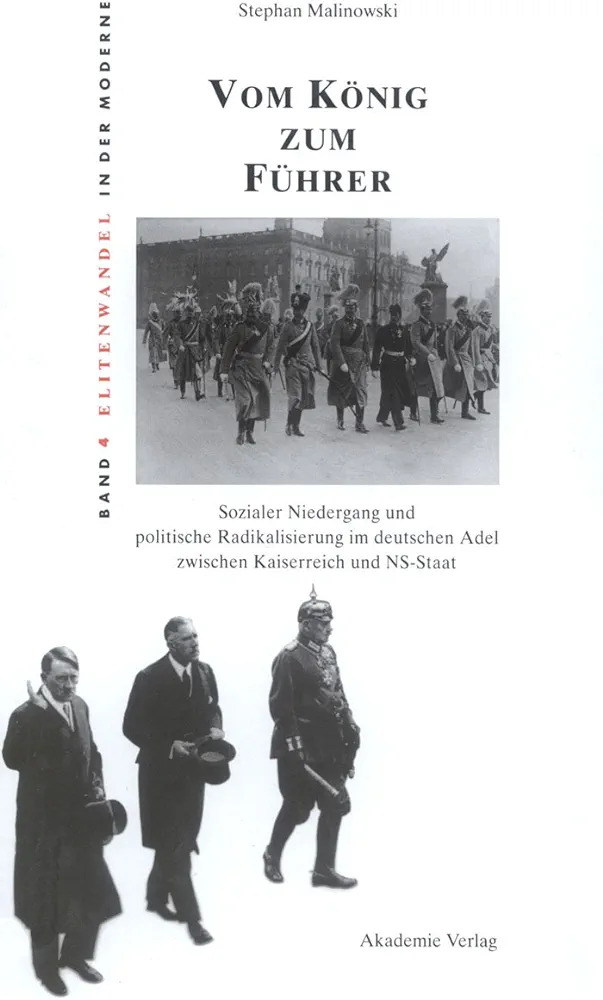
2020 veröffentlichte der Autor eine aktualisierte und überarbeitete Fassung auf Englisch: Nazis and Nobles, und 2021 das hier im Forum schon mehrmals erwähnte Die Hohenzollern und die Nazis.
Vom König zum Führer - Stephan Malinowski - 4. Aufl 2022 - S. 491 schrieb:Eine groteske Variante adliger Versuche, die überall greifbare Führersehnsucht auf sich selbst zu lenken, liefert eine Rede von 1930, in der Wilhelm II. in Doorn die Inflation des Führerbegriffes beklagte:
In einer sonderbaren Mischung aus christlichen und neu-rechten Motiven erneuerte Wilhelm II. seinen Führungsanspruch. Der Führergedanke sei von Gott zuerst den Sumerern „geoffenbart“ worden. König Hammurabi habe den „Führerberuf“ vor 5000, seine eigenen Vorfahren vor 500 Jahren von Gott übertragen bekommen. „Allein, diesen Führern ist wiederum der Führer Jesus Christus!“ Räumlich und gedanklich fern von allen politischen Realitäten ernannte der Exilkaiser Jesus zum jenseitigen, sich selbst zum irdischen „Führer“. Die vorangestelite Passage aus dem Johannes-Evangelium, die der Ansprache den Titel gegeben hatte, bezog der Kaiser-Führer auf sich selbst: „Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“Führer sein! Das will heutzutage jeder. Führer bieten sich allerorten an. Als Führer spielen sich viele auf [...]. Und dennoch, überall der Schrei nach Führern!
S. 510 schrieb:Generalleutnant a. D. August v. Cramon hatte im Oktober 1933 eine an den Reichspräsidenten gerichtete Denkschrift verfaßt, in der die Wiedereinsetzung Wilhelms II. in seine königlichen Rechte, gewissermaßen als Geschenk zu seinem 75. Geburtstag im Januar 1934 vorgeschlagen wurde. Zur „Erbweisheit des Geschlechts“ kämen nunmehr Weisheit und Würde des Alters hinzu. Der „Führergedanke“ müsse zwangsläufig „im unsterblichen Führertum, der Erbmonarchie“ enden und Hitler werde dabei behilflich sein: „Adolf Hitler selbst ist, soweit bekannt, Monarchist.“
S. 509 schrieb:Etwa sechs Wochen nach dem Tag von Potsdam empfing Hitler den kaisertreuen Friedrich v. Berg, den gestürzten DAG-Adelsmarschall. Nach den Informationen, die der anwesende Reichswehrminister Werner v. Blomberg an den „Hausminister“ des Exilkaisers weitergab, hatte Hitler vage, jedoch weitgehende Versprechungen gemacht: „Als Abschluß seiner Arbeit sehe [Hitler] die Monarchie“, hieß es im Gesprächsprotokoll. In Frage käme allerdings allein die Hohenzollernmonarchie, eine Restauration der Throne in den Bundesstaaten sei abzulehnen. Der Zeitpunkt der Restauration sei allerdings noch nicht gekommen und die Monarchie nur als Ergebnis eines siegreichen Krieges denkbar. Bei einer zweiten Unterredung im Oktober 1933, die der Generalbevollmächtigte des Exilkaisers, General a. D. Wilhelm v. Dommes, mit Hitler führte, war die Tonlage bereits deutlich aggressiver. Das monarchistische Drängen seines Gesprächspartners wies Hitler „leidenschaftlich“ zurück: Die Aufgabe bestünde in der Niederwerfung von Kommunismus und Judentum. Der Kronprinz als Person und die Monarchie als Institution seien nicht „hart genug“ für diese Aufgabe. Im Februar 1934 schließlich wies Hitler die Emissäre in äußerst scharfer Form zurück. Das Gesprächsklima hatte sich im Vorfeld durch scharf antimonarchistische Reden aufgeladen, in denen u. a. Baldur v. Schirach und Richard Walther Darre Wilhelm II. als Feigling verhöhnt hatten. Dommes‘ Vorhaben, für die Ehre seines „angegriffenen Herrn mit der Waffe einzutreten“, scheiterte ebenso wie sein Versuch, mit seinen Klagen bei Hitler durchzudringen. In hochfahrendem Ton verbat sich Hitler nunmehr, in seiner „Aufbauarbeit“ fortlaufend von den deutschen Fürsten gestört zu werden. Zur Erreichung dieser Ziele — „Ausrottung der Verbrecher der November-Revolution“ und Aufbau der Reichswehr — benötige er 12-15 Jahre Zeit.
S. 554 schrieb:Anwesend waren u. a. Hermann Göring, Joseph Goebbels, Marie Adelheid Prinzessin zur Lippe (NSDAP-Mitglied seit dem 1.5.1930), Viktor Prinz zu Wied mit Ehefrau (Parteimitglieder seit dem 1.1.1932), der DAB-Leitartikler Walther Eberhard Frhr. v. Medem, die Parteigenossen August Wilhelm Prinz v. Preußen, der Bankier August Frhr. v. d. Heydt und Oberst a. D. Leopold v. Kleist als Vertreter Wilhelms II. Mitglieder des alten Adels trafen in diesem Salon, den Insider der Berliner Gesellschaft als „gesellschaftlichen Mittelpunkt der nationalsozialistischen Bewegung“ einschätzten, mit den prominentesten NS-Führern zusammen. Hitler, Göring und Goebbels sprachen hier mit dem Berliner SA-Chef Wolf Heinrich Graf v. Helldorf und Angehörigen des Hohenzollernhauses. Prinz „Auwi” präsentierte sich im Hause Dirksen in brauner Uniform, er und sein Sohn Alexander — Parteigenosse auch er — wurden hier „in Hitlers Lehre eingeführt“.
S. 555 schrieb:Eine „mobile“ Schnittstelle entstand durch die Aktivitäten der zweiten Ehefrau Wilhelms II., Hermine Prinzessin v. Reuß, die bei ihren Deutschlandaufenthalten in den wichtigsten Zirkeln der politischen Rechten verkehrte. Offenbar nahm sie 1929, am Rande des Nürnberger Parteitages, Kontakt mit der NSDAP-Führung auf. Der Zeitpunkt ihrer ersten Begegnung mit Hitler ist unklar, gut dokumentiert ist hingegen ein Treffen mit Hitler im Salon der Baronin Tiele-Winckler im November 1931. In Anwesenheit der „Kaiserin“, Görings und der adligen Chefberater Wilhelms II. hielt Hitler einen mehrstündigen Monolog, in dem er seine Absicht darlegte, „alle Novemberverbrecher [...] öffentlich strangulieren“ zu lassen. Der Vortrag begeisterte Gastgeberin und Gäste gleichermaßen, die Ehefrau des Kaisers äußerte sich positiv über den „sympathisch[en]“ Hitler, „auch über seinen guten und geraden Gesichtsausdruck und seine guten Augen und ihren Ausdruck ohne Falsch“, Erfreut über das Ergebnis des Treffens faßte Magnus v. Levetzow seine Eindrücke von Hitler in einem Brief an Fürst v. Donnersmarck zusammen: „Er war gut im Tellerchen, Donnerwetter nochmal.“
Friedrich v. Bulöw 1935 - S. 584 schrieb:Auf Blut und Boden baut der Führer sein Drittes Reich. Wir haben seit 7 Jahrhunderten um die Blutauslese gewußt und haben auf altbewährter Rasse und Kultur mit weiser Wahl unseren Blutsstrom aufgebaut und fortgeführt. [...] Alle die großen Ideale, die der Führer dem deutschen Volke gesetzt hat, sie stammen aus alt-germanischem Erbgut und nicht zuletzt aus den tiefsten Schatzkammern des deutschen Adels. So ist der deutsche Adel dem Nationalsozialismus von Grund auf wesens- und stammverwandt. Zur Zeit der roten Regierungen hieß es: herunter mit der Aristokratie, wir wollen alle Proletarier sein. Jetzt heißt es umgekehrt: Der einfache Mann aus dem Volke soll emporsteigen, und auf der Ebene einer wahren Aristokratie wollen wir alle uns wieder treffen. [...] Was die Zukunft uns bringen wird, überlassen wir Gottes Hand und der Erleuchtung des Führers. Eines aber wissen wir. Unser altes Geschlecht ist kein Fremdkörper im Dritten Reich, der morscht und zerfällt, es ist ein tragender Quader im Bau, gehärtet in Jahrhunderten. [...] Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!
Ein Schwachpunkt an der Arbeit ist die Beschränkung auf "Deutschland", der Adel lässt sich nicht in die kleinbürgerliche Vorstellung vom Nationalstaat pressen der zudem in der Form erst enstehen würde, er definiert sich durch seine weitverzweigten Verwandtschaften an den internationalen Höfen und Häusern, sowie seinen ebenso weit verzweigten Stammbaum. Gerade bei einem "Weltkrieg" ist es eine schwerwiegende Beschneidung alles außerhalb "Deutschlands" auszublenden. 1917 nannte sich das ehemals deutsche Haus Sachsen-Coburg und Gotha um in Windsor, die British Royals, Queen Viktoria war Wilhelms II. Großmutter, wird mit keinem Wort erwähnt und auch Habsburg wird keine Handvoll Male erwähnt.
Zudem ist selbst innerhalb Deutschlands der Fokus zum allergrößten Teil bei Preussen, das mag z.T. an der Quellenverfügbarkeit liegen die mit dem Preußischen Staatsarchiv vermutlich besonders gut ist.
